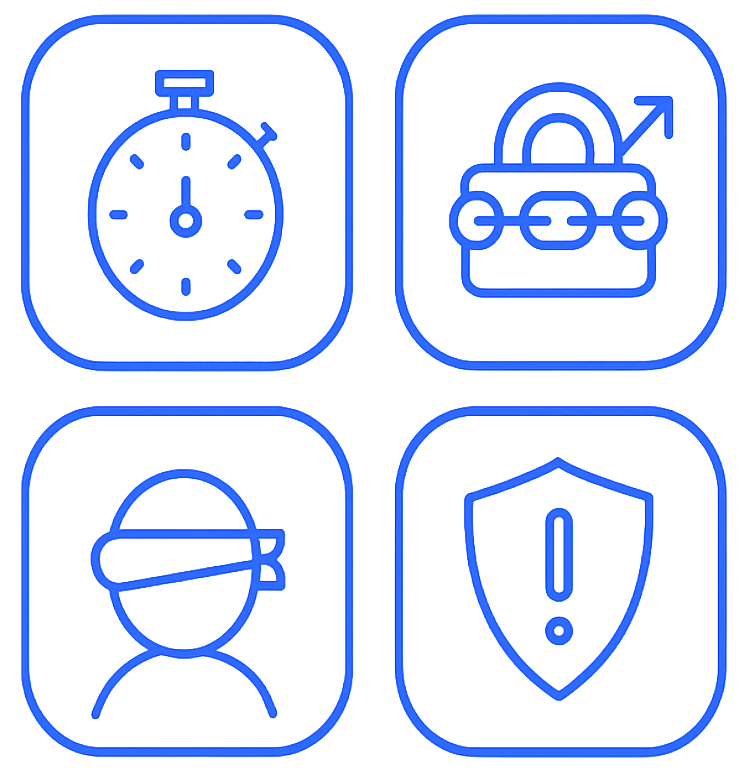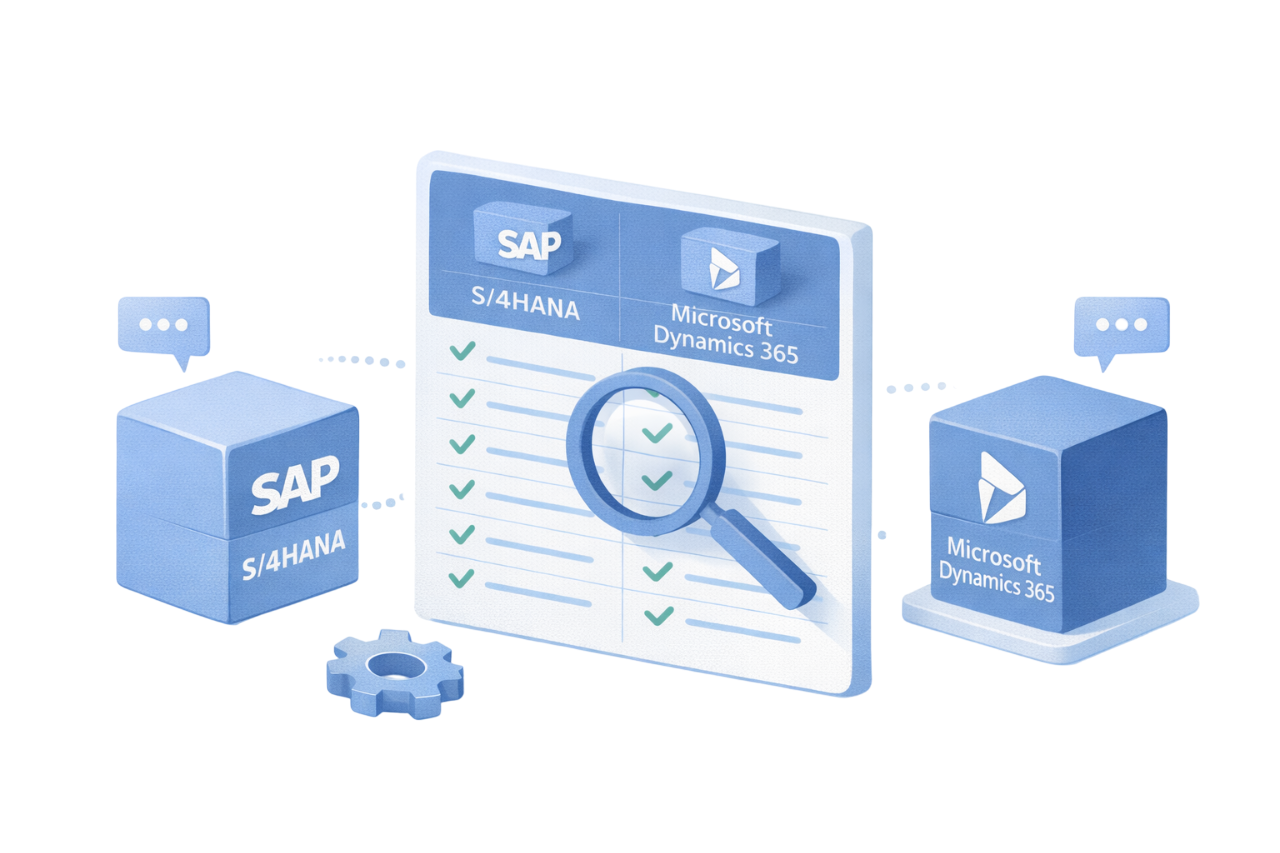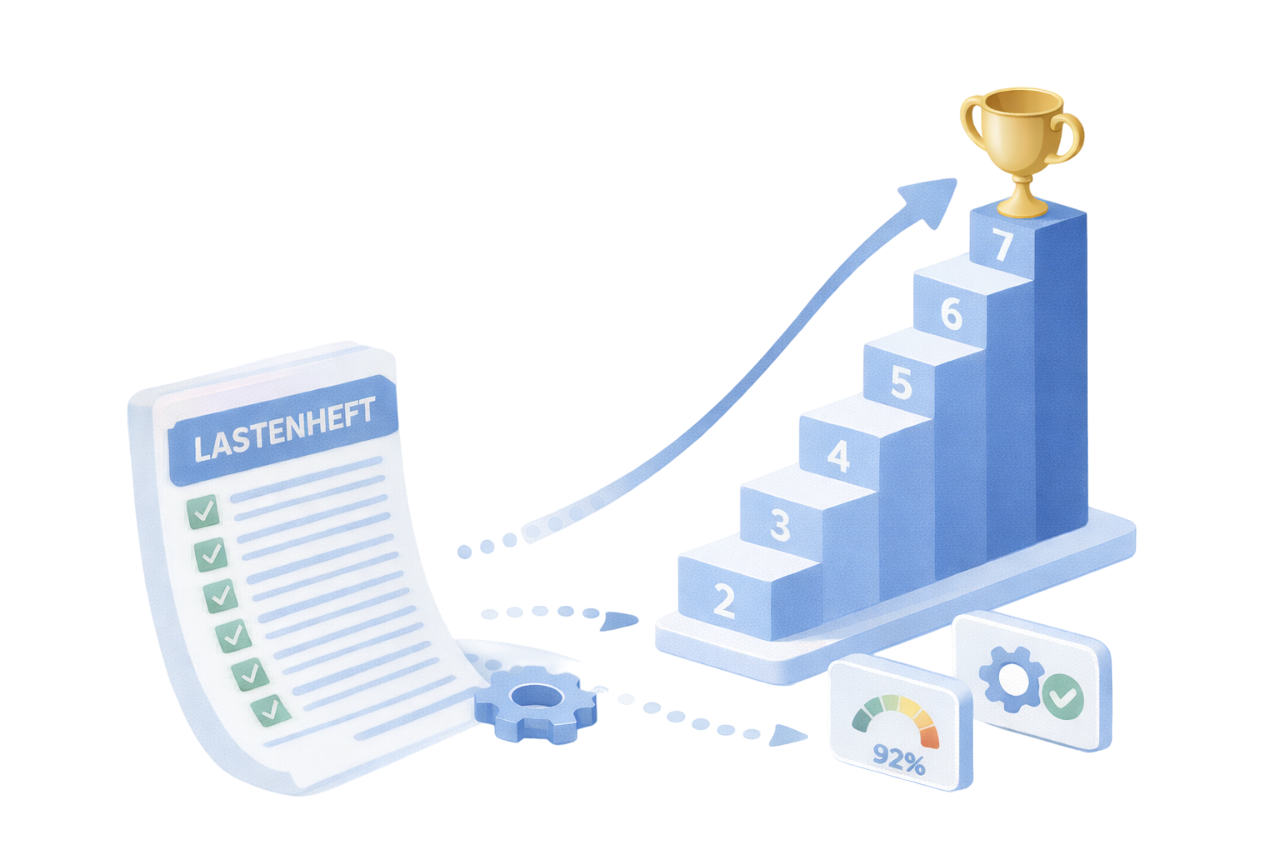Worin bestehen die Risiken der traditionellen Inhouse-Softwareauswahl – und wie vermeiden Sie sie pragmatisch? Traditionelle Auswahlprojekte laufen oft in Eigenregie an: Workshops, Anforderungskataloge, Anbieterrecherche, Demos, Angebotsvergleich. Das erscheint effizient – ist es aber nur, wenn Sie blinde Flecken konsequent schließen. Dieser Beitrag ordnet typische Fallstricke ein, zeigt konkrete Gegenmaßnahmen und verweist auf Ressourcen, mit denen Sie schnell eine neutrale Ausgangsbasis schaffen (z. B. das Pre-Matching auf Find-Your-Software sowie vertiefende Inhalte auf den Spezialseiten ERP, HR, ESG und CRM-Beta).
Warum die Inhouse-Variante attraktiv wirkt – und wo sie kippt
Naheliegend: Fachbereich und IT kennen die Geschäftsprozesse, die Organisation und die Randbedingungen; man spart externe Tagessätze und bleibt unabhängig. In der Praxis kippt diese Rechnung allerdings schnell, wenn (1) Marktabdeckung und Vergleichbarkeit fehlen, (2) die Diskussion in Featurelisten statt Szenarien abrutscht, (3) Integrationsaufwände unterschätzt und (4) Entscheidungsunterlagen nicht „gremientauglich“ aufbereitet sind. Das Ergebnis: Verzögerungen, Nachschärfungen, schlecht vorbereitete Demos und schließlich Verträge, die nicht präzise genug den realen Scope abbilden.
Die 12 häufigsten Risiken – präzise benannt (ausgebaut)
Die folgenden Risiken begegnen uns in nahezu jedem Auswahlprojekt – unabhängig von Branche oder Größe. Unter jedem Punkt finden Sie praxisnahe Erkennungsmerkmale, beeinflussbare Kennzahlen und eine technische Vertiefung, damit Sie nicht nur organisatorisch, sondern auch methodisch-sauber gegensteuern können.
- Frühe Tunnelblicke (Ankereffekt)
Woran Sie es erkennen: 1–2 „gesetzte“ Anbieter dominieren Gespräche; Alternativen dienen nur noch als Feigenblatt. Hintergrund: kognitiver Ankereffekt.
Was es anrichtet: Verengung auf Lösungen, die den Gesamtbedarf nicht abdecken; späte Scope-Erweiterungen verteuern das Projekt.
Frühindikator/KPI: Anteil der Meetingzeit zu einem Produkt > 60 % in den ersten 3 Wochen; Longlist < 8 Kandidaten bei > 3 Domänenanforderungen.
Gegenmaßnahme (sofort): Neutrales Pre-Matching; Longlist/Shortlist strikt trennen; bewusst Kontrastkandidaten aufnehmen (Suite vs. Composable).
Artefakt: 1-seitige Hypothesenmatrix (Suite ↔ Breed, Direktintegration ↔ iPaaS, zentral ↔ dezentral) mit Testfragen.
Technischer Deep Dive: Führen Sie eine Diversitätsquote ein: Mindestens 30 % der Longlist muss sich per Distanzmaß (z. B. Jaccard-Distanz auf Modul-/Architekturmerkmalen) deutlich unterscheiden. Pseudocode-Check:if mean_distance(longlist) < 0.4 → add_contrasts(). - Featureitis statt Use-Cases
Woran Sie es erkennen: 400-zeilige Wunschlisten, aber keine priorisierten Szenarien; Demos zeigen „alles“, jedoch nicht Ihren Alltag.
Was es anrichtet: Unvergleichbare Demos; Reifegrade und Integrationsfähigkeit bleiben unsichtbar.
Frühindikator/KPI: Verhältnis Use-Case-Szenarien zu Einzelfeatures < 1:30; fehlende Ausnahmen (Peak/Fail/Edge).
Gegenmaßnahme (sofort): 6–10 Schlüssel-Use-Cases (Ist/Soll-Flow, Datenobjekte, Ausnahmen, Messgrößen) definieren; daraus Demo-Drehbuch ableiten.
Artefakt: Demo-Leitfaden mit Nachweispunkten („Was muss man sehen?“) und Metriken (Klicks, Durchlaufzeit, Medienbrüche).
Technischer Deep Dive: Schreiben Sie Szenarien im Format<Actor, Trigger, Pre-Conditions, Steps, Events, Post-Conditions, KPIs>. Bewerten Sie je Szenario die Nachweisstärke auf einer 0–3-Skala (0=behauptet, 1=Screenshot, 2=Live-Flow, 3=Live-Flow mit Datenvariante). - Unvollständige Marktabdeckung
Woran Sie es erkennen: 5–8 „bekannte“ Namen; Branchenspezialisten fehlen.
Was es anrichtet: Fehlende Alternativen mit anderem Kosten-/Architekturprofil; spätere Richtungswechsel werden teuer.
Frühindikator/KPI: Abdeckung Zielsegmente (z. B. Fertigung/Handel/Services) und Architekturdiversität (Suite/Composable/Cloud/Prem) pro Shortlist: Soll ≥ 3/3.
Gegenmaßnahme (sofort): Pre-Matching als Breitenfilter; Longlist bewusst divers kuratieren; „blinde Flecken“ markieren.
Artefakt: Markt-Mapping (2×2: Prozess-Fit vs. Integrations-Fit) mit 10–15 Kandidaten.
Technischer Deep Dive: Nutzen Sie eine Coverage-Metrik:coverage = |segments_hit| / |segments_total|undarch_diversity = mean_distance(architectural_vectors). Zielwerte:coverage ≥ 0.6,arch_diversity ≥ 0.5. - „Black-Box“-Bewertungen
Woran Sie es erkennen: Scores vorhanden, aber niemand kann Gewichte/Begründungen erklären; Ergebnisse nicht reproduzierbar.
Was es anrichtet: Lenkungskreise zweifeln; politische Schleifen statt Entscheidung.
Frühindikator/KPI: Nachvollziehbarkeitsquote ≥ 90 %; Versionierung der Scores vorhanden (Ja/Nein).
Gegenmaßnahme (sofort): Gewichtungsmatrix; Nutzwertanalyse; je Kriterium 1-Satz-Begründung + Quelle.
Artefakt: Bewertungsjournal (Kriterium, Gewicht, Score je Anbieter, Begründung, Quelle).
Technischer Deep Dive: Bei AHP prüfen Sie die Konsistenz (Nutzwertanalyse/AHP): Consistency RatioCR = CI/RImit ZielCR < 0.1. Weighted Score:score(vendor)=Σ(w_i·s_{i,vendor}), NormierungΣw_i=1. - Integrationsrisiken unterschätzt
Woran Sie es erkennen: „Schnittstellen später“; Führungshoheiten/Latenzen/Ereignisflüsse ungeklärt.
Was es anrichtet: Mehrkosten, Verzögerungen; Schattenprozesse.
Frühindikator/KPI: Datenhoheiten geklärt für Kunden/Produkte/Preise/Kapazitäten ≥ 80 % vor Demos.
Gegenmaßnahme (sofort): Integrationsmatrix (Quelle/Ziel, Ereignisse, Latenz, Fehlerpfade, Führungshoheit) erstellen; Peak-Szenarien demonstrieren lassen.
Artefakt: 1-seitige Event-Map (z. B. Auftrag → Verfügbarkeit → Kommissionierung → Faktura).
Technischer Deep Dive: Planen Sie auf at-least-once-Semantik mit Idempotenz-Keys und Korrelation-IDs. Definieren Sie akzeptable Latenzen je Event (z. B.stock_updated ≤ 3 s p95) und einen Dead-Letter-Pfad für Fehler. - Hidden TCO
Woran Sie es erkennen: Preisvergleiche ohne Volumina; Migration, Schulung, Betrieb nicht quantifiziert (TCO).
Was es anrichtet: Unterkalkulation, Budgetnachforderungen, abgewürgte Rollouts.
Frühindikator/KPI: TCO-Deckungsgrad (quantifizierte Kostenblöcke) ≥ 95 %; Angebotsposten mit Mengengerüst ≥ 90 %.
Gegenmaßnahme (sofort): Drei TCO-Szenarien (Baseline, Rollout J1–2, Wachstum J3–5) inkl. Rollen/Volumina rechnen.
Artefakt: TCO-Canvas (Subscription/Lizenz, Implementierung, Migration, Integrationen, Betrieb, Schulung, Change).
Technischer Deep Dive: 5-Jahres-TCO mit Abzinsung:TCO = Σ (Cost_t / (1+r)^t). Sensitivität auf 3 Treiber (Useranzahl, Integrationsaufwand, Datenmigration) als Tornado-Chart festhalten. - Stakeholder-Drift
Woran Sie es erkennen: Fachbereiche/IT/Finance/Management gewichten unterschiedlich; es fehlt eine Konsolidierungslogik.
Was es anrichtet: Blockaden, zähe Runden, Entscheidungslähmung.
Frühindikator/KPI: Anzahl Kriterien mit Gewichtungsabweichung > 20 % zwischen Rollen; Eskalationsfälle je Steering-Meeting.
Gegenmaßnahme (sofort): Gewichtungen pro Rolle erheben; moderierte Einigung auf Leitgrößen (Time-to-Value, Risiko, CapEx/OpEx).
Artefakt: Stakeholder-Scorecard (Ziele, Top-3-Kriterien, Muss/No-Go je Rolle).
Technischer Deep Dive: Aggregieren Sie Mehrheitspräferenzen via Borda-Count oder gewichtete Mittelwerte je Rolle; dokumentieren Sie Abweichungen > 1 σ als offene Risiken. - Demo-Theater
Woran Sie es erkennen: Hochglanz-Shows ohne Prozessbezug; keine Metriken; offene Fragen bleiben unbewiesen.
Was es anrichtet: Scheinpräferenzen, die später kollabieren.
Frühindikator/KPI: Nachweisquote (gezeigte Nachweise vs. geforderte) ≥ 85 %; Anteil „Happy-Path“ > 70 % = Alarm.
Gegenmaßnahme (sofort): Demo-Drehbuch vorab; Live-Protokoll; Bewertung je Nachweis statt Gesamteindruck.
Artefakt: Demo-Score-Sheet (Use-Case, Nachweis, Beobachtung, Score, Open-Items).
Technischer Deep Dive: Bewertungsformel pro Use-Case:UC_score = coverage·w₁ + depth·w₂ + exception_proof·w₃, mitΣw=1. coverage=Anteil abgedeckter Schritte, depth=Reifegrad 0–3, exception_proof=Nachweis von Ausnahmen. - RfI/RfP ohne Wiederverwendung
Woran Sie es erkennen: Fragen doppelt/ähnlich gestellt; Antworten in E-Mails/Files verteilt; Versionen unklar.
Was es anrichtet: Mehraufwand, Widersprüche, schlechte Vergleichbarkeit.
Frühindikator/KPI: Duplikat-Quote in Fragen > 10 %; fehlende Antwort-IDs/Referenzen.
Gegenmaßnahme (sofort): Fragenkataloge zentralisieren (Funktionen/Integrationen/Services) mit IDs & Versionierung; Antworten mehrfach referenzieren (RfI/RfP/Demo/PoC).
Artefakt: Q&A-Register (ID, Frage, Status, Gültigkeit, Verwendung).
Technischer Deep Dive: Nutzen Sie kanonische Frage-IDs (F-001…), „single source of truth“ und answer reuse. Vergleichbarkeit via Normalisierung (Skalen/Einheiten fixieren) sichern. - Roadmap-Blindflug
Woran Sie es erkennen: „Heute passt es“; Release-Takt, Deprecations, Ökosystem ungeklärt.
Was es anrichtet: Überraschungen nach 12–24 Monaten; Add-ons, Brüche in Integrationen.
Frühindikator/KPI: Roadmap-Transparenzgrad (Horizont/Takt/Abwärtskompatibilität/Migrationspfade/Partner) – ≥ 4/5 Kriterien belegt.
Gegenmaßnahme (sofort): Roadmap-Interview (12–24 Monate) mit Pflichtfragen zu Sunset-Policies, API-Versionierung, Ecosystem-Plänen.
Artefakt: Roadmap-Risikoliste (Annahme, Eintrittswahrscheinlichkeit, Gegenmaßnahme).
Technischer Deep Dive: Prüfen Sie SemVer (z. B.MAJOR.MINOR.PATCH) und Backward-Compatibility. Definieren Sie Migrations-SLOs (z. B. „Upgrade-Aufwand ≤ N PT je Release“). - Entscheidungsunterlagen ohne „Story“
Woran Sie es erkennen: Tabellen ohne roten Faden; Annahmen/Trade-offs nicht explizit; Empfehlung unklar.
Was es anrichtet: Vertagte Beschlüsse, Rückfragenlawinen, Vertrauensverlust.
Frühindikator/KPI: Story-Dichte: Executive Summary ≤ 1 Seite mit „Warum/Annahmen/Trade-offs/Nächste Schritte“ vorhanden (Ja/Nein).
Gegenmaßnahme (sofort): Entscheidungsvorlage mit 4 Bausteinen: Zielbild, Shortlist-Ergebnis, Variantenvergleich, Empfehlung inkl. Risiken.
Artefakt: One-Pager fürs Gremium (Grafik + Kernaussagen + klare Beschlussbitte).
Technischer Deep Dive: Nutzen Sie das Pyramid-Prinzip (These → Begründung → Evidenz) und markieren Sie „Wenn-dann“-Abhängigkeiten (A gewinnt, wenn Annahme Y gilt). - Time-to-Decision zu lang
Woran Sie es erkennen: Endlose Vorqualifizierung; wechselnde Bewertungsmaßstäbe; Meetings ohne Beschluss.
Was es anrichtet: Opportunitätskosten, Demotivation, technologischer Stillstand.
Frühindikator/KPI: Lead-Time Kick-off → Entscheidung; WIP ≤ 3; Time-Box je Phase eingehalten (Ja/Nein).
Gegenmaßnahme (sofort): Phasen-Time-Box (z. B. 2 Wochen Longlist, 3 Wochen Demos), Exit-Kriterien, „Kill-Switch“ bei Nichteinhaltung.
Artefakt: Entscheidungsfahrplan (Meilensteine, Verantwortliche, Kriterien, Datum, Statusampel).
Technischer Deep Dive: Steuern Sie per Kanban-Metriken (Cumulative-Flow, Lead-/Cycle-Time). WIP-Limit streng halten, sonst explodiert die Durchlaufzeit.
Risikomatrix: Symptome, Folgen, Gegenmaßnahmen
Die Matrix ist Ihr „Schnellprüfer“ für Lenkungskreise. Sie verbindet Symptome mit unmittelbar wirksamen Gegenmaßnahmen. Nutzen Sie sie als Agenda-Gerüst: Jede Zeile erhält einen Owner, eine Frist und ein Nachweis-Artefakt (z. B. aktualisierte Integrationsmatrix).
| Risiko | Typisches Symptom | Konkrete Folge | Sofortmaßnahme |
|---|---|---|---|
| Tunnelblick | „Wir kennen da 2–3 Namen, die passen.“ | Verpasste Alternativen, teure Nachverhandlungen | Früher Neutral-Check über Marktbreite (Pre-Matching) |
| Featureitis | Excel-Listen mit 500 Anforderungen | Unvergleichbare Demos, schwammige Angebote | Use-Case-Drehbuch + Nutzwertanalyse |
| Integrationsblindheit | „Schnittstellen bauen wir später.“ | Projektstopper nach Go-Live, Mehrkosten | Frühe Integrationsmatrix (Quelle/Ziel, Ereignisse, Latenzen) |
| Hidden TCO | Preisvergleiche ohne Mengengerüste | Unterkalkulation von Services/Betrieb | TCO-Szenarien: Baseline vs. Rollout vs. Wachstum |
| Stakeholder-Drift | „Jeder hat seinen Favoriten“ | Blockaden, endlose Schleifen | Gewichtungen je Stakeholder + Konsolidierung |
| Demo-Theater | „Beeindruckend – aber nicht unser Prozess“ | Fehlentscheidungen, Scope-Lücken | Demo-Leitfaden mit Nachweisen & Metriken |
| Black-Box-Bewertung | Scores ohne Begründung/Quelle | Gremienzweifel, Re-Bewertungen | Bewertungsjournal + Gewichtungsmatrix |
| Roadmap-Blindflug | Kein Blick 12–24 Monate | Deprecations, Migrationszwang | Roadmap-Interview + Risikoliste |
| Story fehlt | Tabellenfriedhof | Vertagte Beschlüsse | One-Pager mit Annahmen & Trade-offs |
| Time-to-Decision | Keine Time-Box, WIP hoch | Opportunitätskosten | Phasen-Time-Box + Kill-Switch |
Arbeitsweise: Hängen Sie die Matrix sichtbar an Ihr Projektsystem (z. B. als „Board“). Jede Maßnahme gilt erst als „Done“, wenn das korrespondierende Artefakt abgelegt ist (Journal, Drehbuch, Integrationsmatrix, TCO-Canvas usw.).
Integrationsrisiken – kurz, konkret, prüfbar
Integrationen sind selten „nur Technik“. Wer Führungshoheiten, Ereignisse und Latenzen früh klärt, vermeidet die teuersten Überraschungen. Nutzen Sie die Matrix als Pflichtteil in Demos/PoCs – mit klaren Nachweisen.
| Quelle ↔ Ziel | Typische Daten/Ereignisse | Risiko in der Auswahl | Prüfpunkt in Demo/PoC |
|---|---|---|---|
| CRM ↔ ERP | Kunden, Leads, Aufträge, Preise | Doppelte Stammdaten, Inkonsistenzen | Führungshoheit, Änderungswege, Dublettenlogik |
| Shop ↔ ERP/WMS | Bestellungen, Bestände, Retouren | Inventurabweichungen, Latenzen | Ereignis-/Webhook-Fluss, Peak-Szenario (z. B. Sale-Tag) |
| ERP ↔ BI/DWH | Fakten/Dimensionen, Stammdaten | „Excel-Schattenwelt“ | Inkrementelle Replikation, Event-driven vs. Batch |
| HRIS ↔ Payroll | Stamm- & Bewegungsdaten | Abrechnungsfehler, Medienbrüche | Standard-Connector, Ausnahmehandling (Rückrechnungen) |
| PIM/MDM ↔ Shop/ERP | Artikel, Varianten, Preise, Assets | Versionschaos, lange Time-to-Web | Publikationsworkflow, Delta-Updates, Fallback-Strategie |
| MES ↔ ERP | Rückmeldungen, Maschinenzustände | Verzögerte Ist-Daten, falsche Nachkalkulation | Echtzeit-Rückmeldung, Offline-Puffer, Serien-/Chargenfluss |
Technischer Deep Dive zu Integrationen: Definieren Sie je Fluss (1) Goldene Quelle („System of Record“), (2) Event-Schema mit Version, (3) Latenz-SLOs (p95/p99), (4) Fehlerstrategie (Retry-Backoff, Dead-Letter, manuelle Korrektur), (5) Idempotenz (Dedup per event_id), (6) Observability (Korrelation-ID, Durchlaufzeit, Fehlerraten). Für BI/DWH vermeiden Sie Voll-Extracts; setzen Sie stattdessen auf Change Data Capture (CDC) und modellieren Sie Slowly Changing Dimensions (SCD-2) dort, wo Historisierung fachlich nötig ist. In hochfrequenten Flüssen (Shop ↔ ERP) akzeptieren Sie at-least-once und deduplizieren am Sink; „exactly-once“ ist im Verbund selten realistisch.
Faustregel: Jede Integrationszeile benötigt (1) eine eindeutige Führungshoheit, (2) definierte Ereignisse/Latenzen, (3) eine Fehlerstrategie (Retry/Dead-Letter) und (4) einen Demo-Nachweis – sonst bleibt sie ein Risiko.
Wie Inhouse-Teams Risiken strukturiert abbauen – ohne Hype
Sie brauchen keine „Raketenwissenschaft“, sondern Klarheit über Arbeitsschritte und wenige disziplinierende Artefakte:
- Neutrale Ausgangsbasis: Starten Sie mit einer zügigen, nachvollziehbaren Shortlist, um Anker zu lösen und Breite herzustellen (z. B. über Find-Your-Software; für ERP konkret Find-Your-ERP).
- Use-Case-Drehbuch: Beschreiben Sie 6–10 Szenarien, die „Ihre Realität“ treffen (Monatsabschluss, Retouren, Serviceeinsatz, Variantenfertigung, Onboarding usw.).
- Bewertung mit Gewichtungen: Arbeiten Sie mit Nutzwertanalyse/AHP und dokumentieren Sie Kriterien, Gewichtungen und Scores – besser vermittelbar als „Bauchgefühl“.
- Integrationsmatrix & Datenflüsse: Quelle/Ziel, Latenzen, Ereignisse, Führungshoheit – als Pflichtteil der Demo/PoC-Prüfpunkte.
- TCO-Szenarien statt Preisschnappschuss: Baseline, Rollout, Wachstum; Lizenz, Services, Betrieb, Schulung – immer mit Mengengerüsten.
- Entscheidungsstory: „Warum A gewinnt – unter diesen Annahmen.“ Das beschleunigt Lenkungskreise und schafft Akzeptanz.
Vergleich: traditionelle Inhouse-Auswahl vs. strukturierter Ansatz
| Aspekt | Traditionell (häufig) | Strukturiert (empfohlen) | Nutzen |
|---|---|---|---|
| Startpunkt | Einzelrecherche, Empfehlungen | Neutrale Erst-Shortlist (Marktbreite) | Keine Frühverengung |
| Bewerten | Featureliste, subjektive Eindrücke | Use-Cases + Nutzwertanalyse | Vergleichbarkeit, Nachvollziehbarkeit |
| Integrationen | „Später“ im Projekt | Früh mit Matrix, Peak-Szenarien | Weniger Überraschungen |
| Preisbild | „Listenpreise“ | TCO-Szenarien mit Mengengerüsten | Realistische Planung |
| Entscheidung | „Wir finden A besser“ | „A gewinnt, weil … (Annahmen x/y/z)“ | Gremientauglichkeit |
Use-Cases: Wo Inhouse-Risiken besonders häufig zuschlagen
Fertigung (Mittelstand, 250–1.500 MA): Varianten, NC-Programme, Rückmeldelogik, MES-Schnittstellen. Risiko: Demos zeigen „Happy Path“, Integrationslast taucht später auf. Gegenmaßnahme: Szenarien mit Engineering-Change, Nachkalkulation, Serien-/Batch-Tracking und Peak-Tests.
Retail & E-Commerce (80–500 MA): Omnichannel, Realtime-Bestände, Promotions, Retouren. Risiko: Latenzen, Preis-/Promo-Logik, PIM/MDM werden unterschätzt. Gegenmaßnahme: Ereignisketten, Spitzenlast, Filial-Szenarien im Demo-Leitfaden.
Professional Services (50–2.000 MA): Ressourcenplanung, Timesheets, Revenue Recognition. Risiko: Abrechnungslogik und Projektcontrolling werden als „Detail“ behandelt. Gegenmaßnahme: TCO-Szenarien (Team-Skalierung), Rollen/Mengen und Abrechnungsfälle.
Life Sciences & MedTech: Nachvollziehbarkeit, Chargen, Abweichungen. Risiko: Prüf- und Dokumentationspflichten werden im Auswahlprozess nicht „durchdekliniert“. Gegenmaßnahme: Use-Cases mit Deviations/Change, Lieferantenqualifizierung, End-to-End Tracking.
HR-Modernisierung: Skill-Profile, Onboarding, Payroll, Nachfolge/Karrierepfade. Risiko: „HR ist HR“ – Unterschiede der Prozesse werden flach bewertet. Gegenmaßnahme: Szenarien wie End-to-End-Onboarding, Skill-Gap-Analyse, Payroll-Sonderfälle; Inspiration auf Find-Your-HR.
ESG/Reporting: Datenerhebung, Konsolidierung, KPIs/ESRS. Risiko: Datenherkunft und Plausibilisierung unklar. Gegenmaßnahme: Datenfluss-Szenarien, Quell-/Zielsysteme und Prüfregeln; Einstieg über Find-Your-ESG.
CRM-Erneuerung (Beta-Fokus): Pipeline, Aktivitäten, Integrationen in ERP/Marketing. Risiko: UI-Vorlieben überdecken Prozess- und Datenlogik. Gegenmaßnahme: Szenarien zu Lead-Routing, Dubletten, Angebots-Sync; Blick in die CRM-Beta.
Pragmatische Werkzeuge: Was wirklich hilft
- Checkliste „Projektstart“: Ziele, Scope-Grenzen, Hypothesen (Suite vs. Breed), Stakeholder, Time-box.
- Use-Case-Katalog (10 Szenarien): Jeder Use-Case enthält Nachweispunkte und Metriken (Klicks, Medienbrüche, Durchlaufzeit).
- Integrationsmatrix (1 Seite): Quelle/Ziel, Führungshoheit, Latenz, Ereignisse, PEAK-Test.
- Nutzwertanalyse: 6–10 Kriterienbündel, Gewichtungen pro Stakeholder, Konsolidierung, Audit-Trail.
- TCO-Szenarien: Baseline/Rollout/Wachstum mit Mengengerüsten; Lizenz, Services, Betrieb, Schulung.
- Entscheidungsstory: „Warum gewinnt A – unter Annahmen x/y/z; was wäre, wenn …?“
Externe Orientierung (neutral und nützlich)
- Nutzwertanalyse – etablierte Methode für strukturierte Vergleiche.
- Ankereffekt – psychologischer Hintergrund früher Tunnelblicke.
- BPMN 2.0 – Prozesse so beschreiben, dass Demos sie prüfen können.
- Total Cost of Ownership – Rahmen, um „Preis“ nicht mit „Kosten“ zu verwechseln.
- Event-Driven Architecture – warum Ereignisse/Latenzen in Integrationen zählen.
Weiterlesen & vertiefen (intern)
- Find-Your-ERP – Blog/Insights (Auswahl, Trends, Entscheidungsleitfäden)
- Find-Your-HR – Blog (Vorbereitung, Shortlist, HR-Use-Cases)
- Find-Your-Software – Blog (übergreifende Perspektiven)
Was Sie jetzt tun können – in 5 Schritten
- Neutrale Ausgangsbasis schaffen: Starten Sie ein schnelles, nachvollziehbares Pre-Matching auf Find-Your-Software; für ERP führt der Einstieg direkt über Find-Your-ERP.
- Use-Case-Drehbuch schreiben: 6–10 Szenarien mit Nachweispunkten/Metriken – die Grundlage für Demos und PoCs.
- Integrationsmatrix & TCO-Szenarien anlegen: Frühzeitig, kurz, prüfbar – so vermeiden Sie spätere Überraschungen.
- Bewertung strukturieren: Nutzwertanalyse mit Gewichtungen je Stakeholder; klare Konsolidierung.
- Entscheidungsstory vorbereiten: Ergebnisse so aufbereiten, dass Lenkungskreise zügig beschließen können.
FAQ zu Risiken der traditionellen Inhouse-Softwareauswahl
Warum kippt die Inhouse-Auswahl so oft nach einem guten Start?
Weil frühe Favoriten, Featurelisten und Einzelrecherche den Blick verengen. Ohne neutrale Basis, Use-Cases und Integrations-/TCO-Sicht entsteht kein belastbarer Vergleich.
Wie verhindere ich Demo-Theater?
Mit einem Demo-Leitfaden: 6–10 Use-Cases, zu jedem klare Nachweispunkte und Metriken. Anbieter wissen, was zu zeigen ist; Ihr Team weiß, worauf zu achten ist.
Reicht ein Preisvergleich nicht aus?
Nein. Ohne Mengengerüste, Services, Betrieb, Schulung und Wachstumsszenarien verwechseln Sie „Preis“ mit „Kosten“ – das rächt sich im Rollout.
Wie bekomme ich Marktbreite, ohne Monate zu investieren?
Mit einem schnellen, nachvollziehbaren Pre-Matching als Startpunkt und anschließender Fokussierung. So lösen Sie den Ankereffekt und sparen Vorqualifizierungszeit.
Wo finde ich weiterführende Ressourcen?
Übergreifend auf Find-Your-Software, domänenspezifisch auf Find-Your-ERP, Find-Your-HR, Find-Your-ESG und für CRM in der Beta-Vorschau.
Fazit: Die größten Risiken der traditionellen Inhouse-Softwareauswahl sind keine „Pannen“, sondern Muster: Frühverengung, Featureitis, Integrationsblindheit, Hidden TCO und unstrukturierte Entscheidungen. Mit neutralem Pre-Matching, Use-Case-Drehbuch, Integrations- und TCO-Sicht sowie einer klaren Entscheidungsstory reduzieren Sie diese Risiken drastisch – schnell, nachvollziehbar und ohne Overpromises. Den ersten Schritt setzen Sie heute auf Find-Your-Software; vertiefende Einstiege finden Sie auf Find-Your-ERP, Find-Your-HR, Find-Your-ESG und in der CRM-Beta.