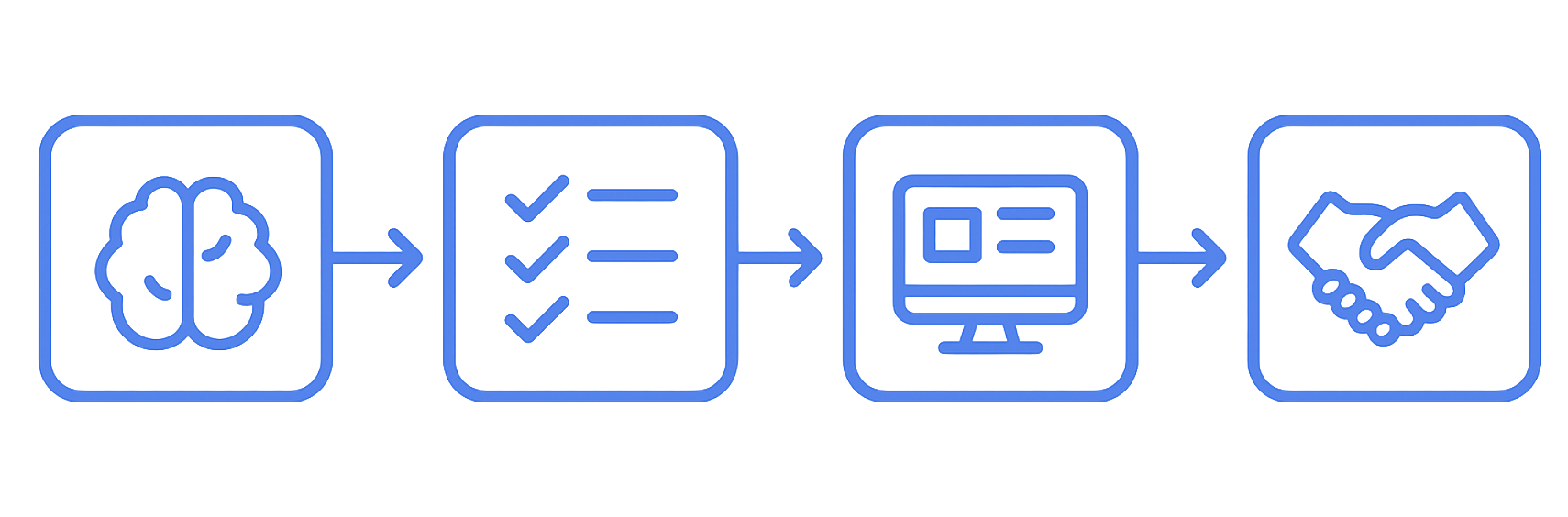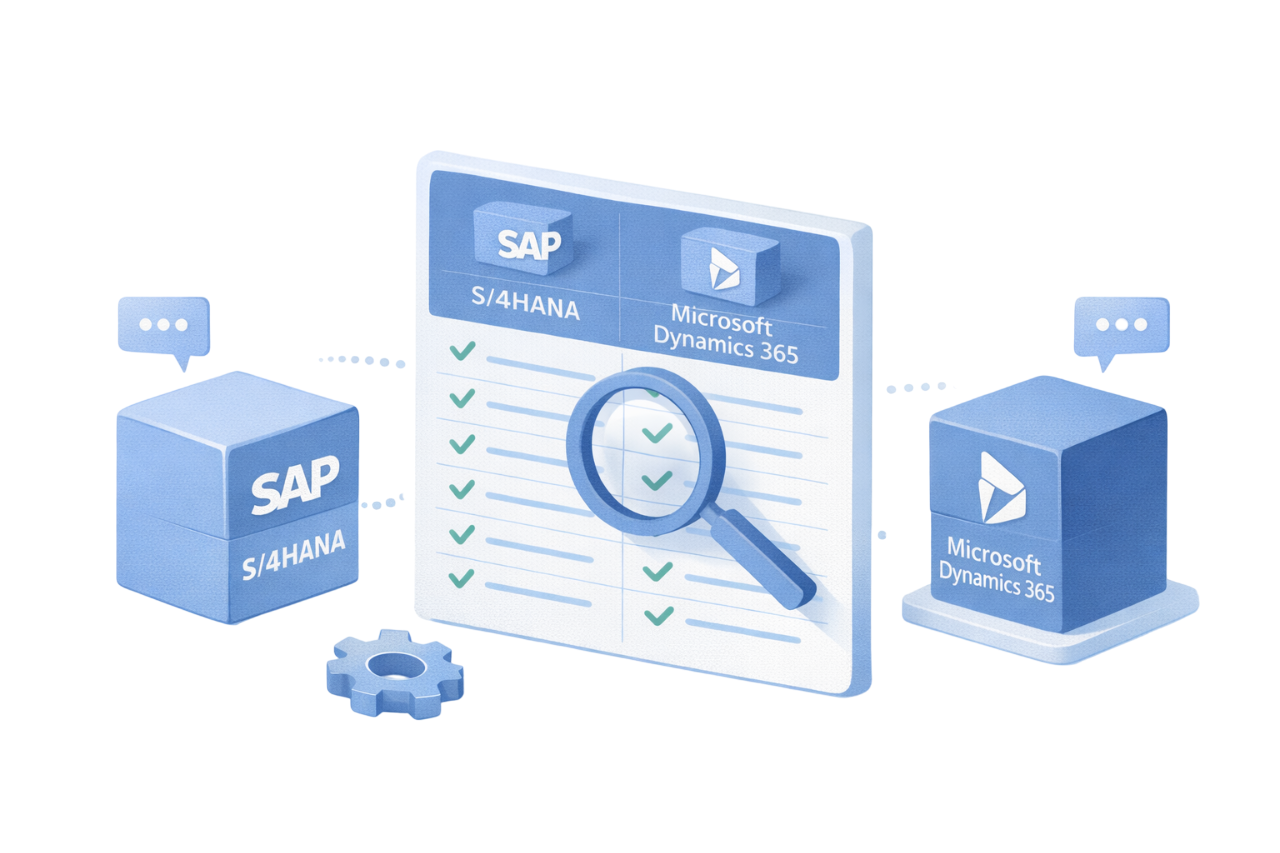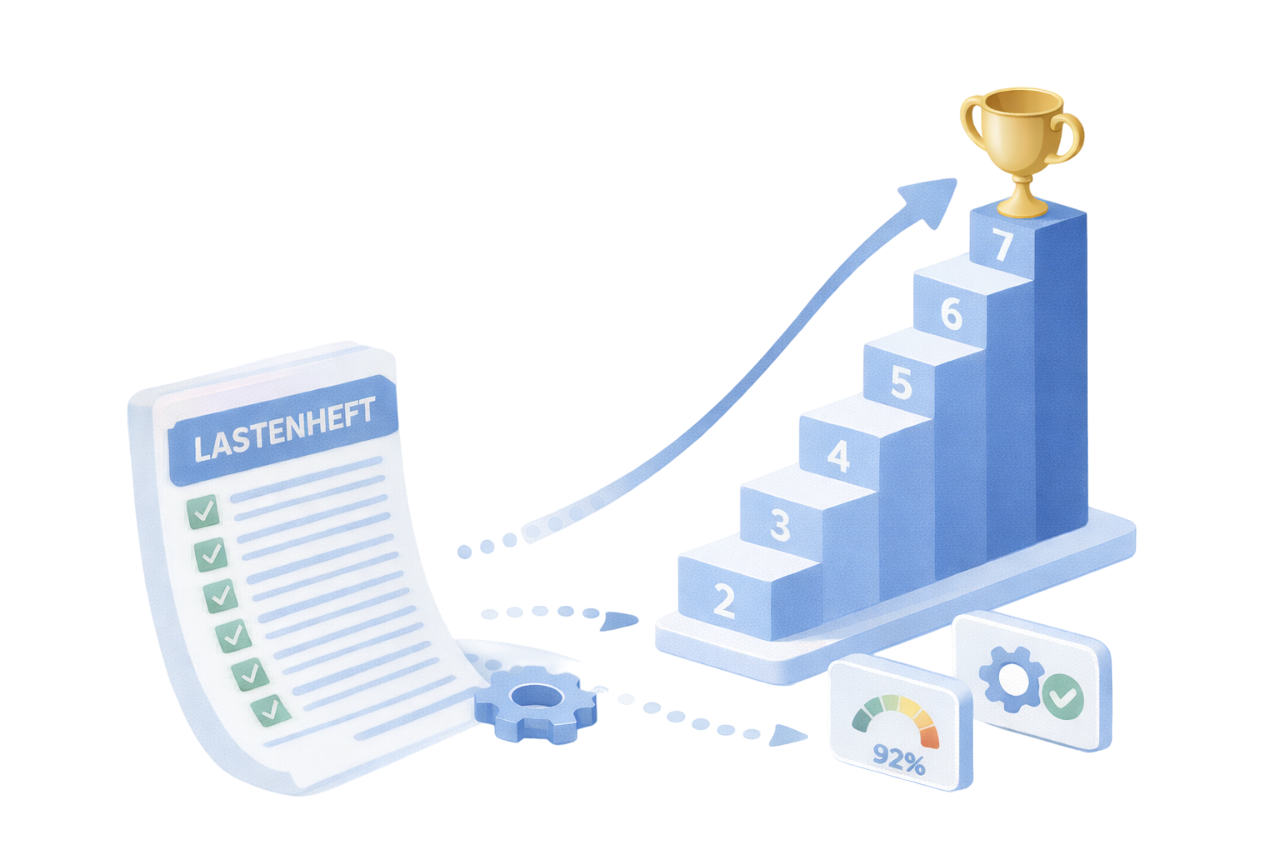Die strukturierte Softwareauswahl ist ein klares, wiederholbares Vorgehen vom ersten Marktüberblick bis zur entscheidungsreifen Vorlage: schnell starten, neutral bleiben, Ergebnisse nachvollziehbar dokumentieren. Genau diesen Einstieg bietet Find-Your-Software – Sie beginnen mit einem kompakten Matching und erhalten binnen Minuten eine begründete Erst-Shortlist, die Sie anschließend im Team verfeinern. Der direkte Einstieg ist dadurch kein monatelanges Foliensammeln, sondern ein pragmatischer „Klick → Ergebnis“-Moment, der Diskussionen fokussiert und Aufwand spart.
Warum die strukturierte Softwareauswahl heute wichtiger ist als je zuvor
Die Realität im Jahr 2025 ist: Märkte bewegen sich schnell, Produktlandschaften verzweigen sich, und Schnittstellen entscheiden oft mehr über den Erfolg als einzelne Features. Ohne Struktur kippt ein Auswahlprojekt rasch in drei typische Sackgassen: Erstens der Tunnelblick auf zwei, drei „bekannte“ Anbieter. Zweitens das Feature-Sammeln ohne echten Prozessbezug – Listen wachsen, Erkenntnis nicht. Drittens Demos, die beeindrucken, aber wenig belegen. Eine strukturierte Softwareauswahl adressiert genau das – nicht mit mehr Papier, sondern mit wenigen, präzisen Bausteinen: ein schneller, neutraler Einstieg für breite Sicht ohne Recherchemühle; danach messbare Vertiefung mit Use-Case-Drehbuch, Bewertungsjournal, Integrationsmatrix und TCO-Szenarien. So entsteht ein nachvollziehbarer „Audit-Trail“, der in Gremien trägt – und intern für Ruhe sorgt, weil klar ist, warum eine Lösung vorn liegt und unter welchen Annahmen.
Hinzu kommt ein weiterer Trend: Entscheidungen werden heute seltener in einer IT-Abteilung allein getroffen. Fachbereiche, IT, Finanzen und Management müssen zusammenfinden – auf Augenhöhe. Die strukturierte Softwareauswahl gibt dafür die gemeinsame Sprache: echte Prozessszenarien statt Buzzwords, nachvollziehbare Kriterien statt Bauchgefühl, dokumentierte Annahmen statt impliziter Erwartungen. Das beschleunigt nicht nur den Weg zur Entscheidung, es reduziert vor allem die teuren Schleifen danach.
So beginnen Sie: vom Klick zum Ergebnis – in wenigen Minuten
Der Einstieg ist bewusst schlank gehalten: Auf Matching Engine starten Sie das Pre-Matching und erhalten eine neutrale Erst-Shortlist – inklusive Einblick, warum bestimmte Systeme vorgeschlagen werden. Von dort wechseln Sie direkt ins Selection Portal, um mit Ihrem Team strukturiert weiterzuarbeiten: Anforderungen verdichten, Kandidaten vergleichen, Demos planen, Ergebnisse dokumentieren – alles an einem Ort.
Wenn Sie thematisch tiefer einsteigen möchten, stehen die spezialisierten Portale bereit: Find-Your-ERP für Enterprise-Ressourcenplanung, Find-Your-HR für Personalprozesse, Find-Your-ESG für Nachhaltigkeits- und Reporting-Themen sowie die Beta-Vorschau für CRM unter Find-Your-CRM (Preview). Der Grundgedanke bleibt identisch: schneller, nachvollziehbarer Start – anschließend sauber strukturiert vertiefen.
Wichtig für die Zusammenarbeit im Alltag: Nach der Shortlist teilen Sie im Portal Ihre Anforderungen und Ergebnisse mit allen Beteiligten – gesteuert über ein Rollen- und Rechtekonzept, damit Lenkungskreis, Fachbereiche und IT passgenau mitarbeiten können. Szenarien für Webcasts (Agenda, „Was muss man sehen?“, Bewertungsbögen) legen Sie vorab an und teilen sie im Termin an alle Teilnehmenden. Jede Person kann Kommentare hinterlassen, Fragen markieren und Rückmeldungen platzieren. So entsteht eine lückenlose Dokumentation, die alle Meinungen abholt. Die Auswertung der Bewertungen funktioniert auf Knopfdruck, und Unterlagen der Anbieter (Angebote, Folien, Protokolle) speichern Sie zentral und auffindbar im Projekt-Workspace des Portals. Genau diese durchgängige Arbeitsweise macht die strukturierte Softwareauswahl im Team greifbar – und hält den Fokus auf Fakten statt auf E-Mail-Threads.
Warum Begleitung zählt – und wie wir Partner auf Augenhöhe sind
Die meisten Unternehmen wählen nur selten neue Kernsysteme aus – oft vergehen Jahre zwischen zwei großen Entscheidungen. Das ist völlig normal, bedeutet aber auch: Die nötige Routine und Methodik ist intern nicht immer präsent. Zugleich spüren viele Organisationen den branchenweiten IT-Fachkräftemangel: Kapazitäten sind knapp, Prioritäten stapeln sich, Zeitfenster bleiben klein. Genau hier setzt die strukturierte Softwareauswahl an – sie reduziert die Einstiegshürde und macht den Prozess für alle Beteiligten beherrschbar.
Unser Anspruch ist nüchtern: Wir wollen Partner sein – dort, wo es sinnvoll ist. Die Matching Engine liefert in kurzer Zeit eine begründete Ausgangsbasis; das Selection Portal hält den roten Faden bis zur entscheidungsreifen Vorlage. Dazwischen liegt Teamarbeit: Use-Cases zuschneiden, Demos vorbereiten, Integrationsflüsse klären, TCO-Szenarien rechnen, Annahmen offenlegen. Wir strukturieren diesen Weg, bringen bewährte Artefakte mit – und achten darauf, dass Entscheidungen tragfähig sind: transparent, reproduzierbar, gremiumstauglich.
Ob Sie intern stark aufgestellt sind oder punktuell Unterstützung brauchen: Mit einer strukturierten Softwareauswahl schaffen Sie Klarheit – über Anforderungen, über Kandidaten und über den Weg zum Beschluss. Und falls Sie den ersten Schritt setzen möchten: Der direkte Einstieg ist nur einen Klick entfernt – über die Matching Engine und das Selection Portal.
Worin die Stärken von Find-Your-Software liegen – knapp und nüchtern
Schneller, neutraler Start. Statt Wochen an Einzellinks und PDFs zu sichten, erhalten Sie in Minuten eine begründete Erst-Shortlist. Das ist kein endgültiges Urteil, sondern eine Arbeitsgrundlage, die Sie bewusst verfeinern.
Nachvollziehbare Ergebnisse. Empfehlungen sind keine Black Box, sondern mit Gründen hinterlegt. Das erleichtert die interne Verständigung zwischen Business, IT und Finance – und spart Schleifen im Lenkungskreis.
Durchgängige Vertiefung. Vom Vergleich über Demos bis zur Entscheidungsvorlage arbeiten Sie an einem Ort weiter.
Die strukturierte Softwareauswahl in 4 Etappen
Damit Sie nicht in endlosen Rechercheschleifen hängenbleiben, übersetzt diese Etappenfolge die Idee der strukturierte Softwareauswahl in handhabbare Arbeitsschritte. Jede Etappe erzeugt messbare Ergebnisse („Artefakte“), die Sie im Team teilen und im Lenkungskreis beschlussfähig machen.
- Pre-Matching: In wenigen Minuten zur neutralen Shortlist – das „erste Bild“ des Marktes. Ziel: Breite schaffen, Ankereffekte vermeiden, Hypothesen definieren.
Sofort starten: Das Pre-Matching initiieren Sie über die Matching Engine. Nach der Shortlist wechseln Sie nahtlos ins Selection Portal, um dort strukturiert weiterzuarbeiten.
Zielbild: 3–6 Kandidaten mit kurzer Begründung, warum sie in die nächste Runde gehören. Sie starten bewusst breit, um frühe Tunnelblicke zu vermeiden.
Die Arbeitsschritte (der Matching Engine):
- Kontext aufnehmen: Unternehmens-URL, Branche, Zielmärkte, Rollout-Horizont notieren. Keine Feature-Listen – es geht um Kontext.
- Hypothesen festhalten: Suite vs. Best-of-Breed, zentrale vs. dezentrale Stammdaten, Cloud-first vs. Hybrid. Diese Hypothesen werden später getestet, nicht „bewiesen“.
- Shortlist kuratieren: Mindestens ein „Kontrastkandidat“ (andere Architektur/Preismodell) gehört in jede Shortlist.
Kollaboration nach der Shortlist (im Portal): Teilen Sie Anforderungen und Ergebnisse mit allen Beteiligten – direkt im Selection Portal. Über Rollenmanagement steuern Sie Berechtigungen (z. B. Lenkungskreis, Fachbereiche, IT). Legen Sie Szenarien für Webcasts an (Agenda, Fragenkataloge, Bewertungsbögen) und teilen Sie diese in den Webcasts an das gesamte Projektteam. Jede Person kann Kommentare hinterlassen; Abstimmungen und Freigaben sorgen dafür, dass niemand „unter dem Radar“ bleibt. Die Auswertung funktioniert auf Knopfdruck – Scores, Zusammenfassungen und Übersichten werden automatisch erzeugt. Erhalten Sie Dokumente von Anbietern (Angebote, Folien, Protokolle), legen Sie diese zentral und übersichtlich im Portal ab – statt sie in Mails oder Ordnern zu verstreuen.
Artefakte: 1-seitige Hypothesenmatrix, Shortlist-Export, Notiz mit Annahmen/Offenen Fragen.
Messgrößen: Diversitätsquote der Shortlist (z. B. Anteil composable vs. Suite), Anteil „Kontrastkandidaten“ ≥ 20 %.
Typische Fehler: Zu frühe Verengung auf Favoriten, fehlende Dokumentation von Annahmen. Beides untergräbt die strukturierte Softwareauswahl.
- Use-Cases & Demos: 6–10 Schlüssel-Szenarien beschreiben (Ist/Soll, Ausnahmen, Datenobjekte, Messgrößen). Demos liefern Nachweise, keine Show.
Zielbild: Ein Demo-Drehbuch, das reale Abläufe belegt – inklusive Ausnahmen und Messpunkten. Statt „kann das System X?“ heißt es: „Zeigen Sie End-to-End so – mit diesen Daten, in dieser Reihenfolge.“
Arbeitsschritte:
- Szenarien schneiden: 6–10 Use-Cases, je 6–12 Schritte, inkl. Peak-/Fehlerszenarien. Beispiel Handel: „Retouren mit Seriennummer & Preisgutschrift“ (Bestand, Bewertung, Accounting).
- Datenobjekte festlegen: Stammdaten (Kunde, Artikel, Preis), Bewegungen (Bestellung, Rückmeldung), Hilfsobjekte (Belege, Referenzen) – und was davon im Nachweis sichtbar sein muss.
- Messgrößen definieren: Nachweisquote (gezeigte vs. geforderte Punkte), Klickpfade/Medienbrüche, p95-Durchlaufzeiten an kritischen Stellen.
Im Portal: Hinterlegen Sie Use-Cases, Fragenkataloge und Bewertungsbögen zentral. Für Webcasts teilen Sie die vorbereiteten Szenarien per Klick an alle Teilnehmenden; Kommentare & Rückfragen landen direkt am jeweiligen Nachweispunkt – das sichert eine lückenlose Dokumentation und holt alle Meinungen ab.
Artefakte: Demo-Leitfaden (Use-Case, Nachweis, „Was muss man sehen?“, Metriken), Protokollvorlage für Beobachtungen und Offene Punkte.
Messgrößen: Nachweisquote ≥ 85 %, Anteil „Happy-Path“ < 70 %, mindestens 2 Ausnahmeszenarien je kritischem Prozess.
Typische Fehler: Folien statt Live-Nachweise, kein roter Faden, keine Ausnahmen. Diese Fehler lassen die strukturierte Softwareauswahl wie „Show & Tell“ wirken – vermeiden Sie das mit klaren Nachweispunkten.
- Vergleich & Bewertung: Bewertungsjournal mit Kriterien, Gewichtungen, Begründungen. Integrationsmatrix und TCO-Szenarien als Pflichtteile.
Zielbild: Reproduzierbare Scores mit kurzer textlicher Begründung je Kriterium – plus ein transparenter Blick auf Integrationsflüsse und Gesamtkosten-Varianten.
Arbeitsschritte:
- Kriterien bündeln: Prozess-Fit, Integrations-Fit, Roadmap-Passung, Referenzen, nicht-funktionale Eigenschaften, Kosten (mind. 6 Bündel).
- Gewichten & begründen: Gewichte pro Bündel festlegen (z. B. 25/20/15/15/15/10 %), je Teilkriterium 1 Satz „warum“ (Quelle: Demo-Nachweis, Referenz, Dokumentation).
- Integrationsmatrix: Quelle ↔ Ziel, Ereignisse/Webhooks, Latenz-Ziele, Fehlerpfade, Führungshoheit (wer „besitzt“ Kunden, Produkte, Preise?).
- TCO-Szenarien: Baseline, Rollout (Jahr 1–2), Wachstum (Jahr 3–5) – jeweils mit Rollen/Volumina, Implementierung, Migration, Betrieb, Schulung.
Im Portal: Bewertungen, Kommentare, Abstimmungen und Freigaben laufen an einem Ort zusammen. Die Auswertung erfolgt per Knopfdruck – inklusive automatisch erzeugter Übersichten und Zusammenfassungen. Anbieter-Dokumente (Angebote, Leistungsbeschreibungen, Präsentationen) speichern Sie strukturiert im Projekt-Workspace, damit alles auffindbar bleibt.
Artefakte: Bewertungsjournal (Kriterium, Gewicht, Score, Begründung), Integrationsmatrix (1 Seite), TCO-Canvas (3 Szenarien, Zahlenbandbreiten).
Messgrößen: Begründungsquote ≥ 90 %, geklärte Datenhoheiten ≥ 80 %, TCO-Deckungsgrad ≥ 95 % der Kostenblöcke quantifiziert.
Typische Fehler: „Black-Box“-Scores ohne Begründung, Integrationen „später“, Preis-Schnappschüsse ohne Volumina. Solche Lücken konterkarieren die strukturierte Softwareauswahl.
- Entscheidungsvorlage: One-Pager mit Zielbild, Variantenvergleich, Empfehlung „unter Annahmen“, Risiken, nächsten Schritten. Beschlussfähig in einem Gremiumstermin.
Zielbild: Ein verdichtetes Dokument, das den Beschluss ermöglicht – kein Tabellengrab, sondern eine klare Geschichte: Warum gewinnt Lösung A, unter welchen Annahmen, mit welchen Risiken und Nächsten Schritten.
Arbeitsschritte:
- Executive Summary: Zielbild, Nutzen, Zeithorizont.
- Variantenvergleich: 2–3 Favoriten mit Kerndifferenzen (Prozess-/Integrations-Fit, Roadmap, TCO-Bänder).
- Empfehlung „unter Annahmen“: Explizit machen, welche Hypothesen gelten (z. B. Rollout-Reihenfolge, Nutzerklassen, Datenhoheit).
- Risiken & Mitigations: Top-3 Risiken mit Gegenmaßnahmen, Verantwortlichen und Fristen.
- Nächste Schritte: Vertrag/PoC/Feinspezifik, Meilensteine, Verantwortlichkeiten.
Im Portal: Aus den erfassten Bewertungen, Kommentaren und Dokumenten generieren Sie die Vorlage schnell und strukturiert. Das schließt den Kreis der strukturierte Softwareauswahl – transparent, zügig und teamfähig.
Artefakte: One-Pager, Anhang mit Bewertungsjournal, Integrationsmatrix, TCO-Canvas.
Messgrößen: Zeit vom Demo-Abschluss bis Beschluss ≤ 15 Arbeitstage; offene Punkte ≤ 5, alle mit Owner/Termin.
Typische Fehler: Empfehlung ohne Annahmen, keine Mitigations, fehlende „Bitte um Beschluss“.
Use Cases – wie strukturierte Softwareauswahl in der Praxis hilft
KMU (Fertigung, 120 MA): Ausgangslage: ERP zu starr, unklare Dispositionslogik, Excel-Nachkalkulation. Vorgehen: Pre-Matching als Start, 6–8 Szenarien (Variantenstückliste, Rückmeldungen aus der Fertigung, Serien-/Chargenfluss). Demo-Drehbuch mit Nachweispunkten („Rohwarenengpass – Umplanung & Auswirkung auf Liefertermin“ inkl. Planung, Reservierung, Materialentnahme, Nachkalkulation). Bewertungsjournal (z. B. Produktionsplanung 25 %, Beschaffung 20 %, FI/CO 15 %, Reporting 15 %, Stammdatenführung 15 %, Service 10 %). Ergebnis: Eine begründete Empfehlung, die zeigt, warum sie trägt – nicht nur „welche“ Lösung gewinnt.
Retail/E-Commerce (Scale-up, 80 MA): Ausgangslage: Wachstum, Peak-Lasten, hohe Retourenquote. Vorgehen: Pre-Matching, Integrationsmatrix (Shop ↔ ERP/WMS: Bestände, Reservierungen, Retouren; Ziel-Latenz p95 im Sale-Szenario definieren), Demos mit Nachweisen zu „Sale-Tag“ (Bestandsabbuchung in Peaks, Preis-/Promo-Logik) und Dublettenlogik im CRM. Ergebnis: Klarheit über Führungshoheiten (Preis/Promo/Bestand), spürbar geringeres Integrationsrisiko vor Go-Live.
Professional Services (200 MA): Ausgangslage: HR-Stack historisch gewachsen, manuelle Arbeit. Vorgehen: HR-Einstieg nutzen, Use-Cases zu Zeiterfassung, Abwesenheit, Onboarding, Payroll-Ausnahmen; Bewertungsjournal um nicht-funktionale Kriterien erweitern (Wartbarkeit, Usability, Änderungsaufwand). Ergebnis: Entscheidungsreife in Wochen statt Monaten – mit dokumentierter Logik anstelle von Meinungen.
Unternehmensgruppe (Carve-out): Ausgangslage: Schnelle Neuaufstellung, heterogene Tochtergesellschaften. Vorgehen: Breite Longlist mit „Kontrastkandidaten“ (Suite vs. composable), Roadmap-Interviews als Pflichtteil, TCO-Szenarien Baseline/Rollout/Wachstum mit Rollen/Volumina. Ergebnis: Ein Beschluss „unter Annahmen“, der spätere Diskussionen minimiert und die Rollout-Reihenfolge transparent macht.
Tabelle 1: Funktionen vs. Nutzen (SERP-freundlich)
| Funktion (Auswahlphase) | Konkreter Nutzen |
|---|---|
| KI-gestütztes Pre-Matching | Neutrale Shortlist in Minuten; spart Recherchezeit und löst Ankereffekte. |
| Begründete Ergebnisse | Nachvollziehbarkeit im Gremium; weniger „Bauchgefühl“ und weniger Schleifen. |
| Kuratierte Vertiefung | Vom Vergleich über Demos bis zur Vorlage – kontinuierlicher Arbeitsfluss. |
| Spezialisierte Einstiege (ERP/HR/ESG) | Domänenspezifische Orientierung; schneller von „allgemein“ zu „konkret“. |
| CRM-Preview | Früher Zugang zur Logik der künftigen CRM-Auswahl (Beta-Vorschau). |
Tabelle 2: Integrationsmatrix – kurz, konkret, prüfbar
| Quelle ↔ Ziel | Typische Daten/Ereignisse | Risiko in der Auswahl | Prüfpunkt in Demo/PoC |
|---|---|---|---|
| CRM ↔ ERP | Kunden, Leads, Aufträge, Preise | Doppelte Stammdaten, Inkonsistenzen | Führungshoheit, Änderungswege, Dublettenlogik |
| Shop ↔ ERP/WMS | Bestellungen, Bestände, Retouren | Inventur-Deltas, Latenz bei Peaks | Webhook/Event-Fluss, p95-Latenz im Sale-Szenario |
| ERP ↔ BI/DWH | Fakten/Dimensionen, Stammdaten | „Excel-Schattenwelt“ | CDC statt Voll-Extract; SCD-2 nur wo nötig |
| HRIS ↔ Payroll | Stamm- & Bewegungsdaten | Fehler in Abrechnung | Standard-Connectoren, Ausnahme-Handling |
Praxis-Hinweis: Jede Integrationszeile braucht vier klare Antworten: (1) Goldene Quelle (System of Record), (2) Ereignisse & Ziel-Latenzen (p95/p99), (3) Fehlerstrategie (Retry/Dead-Letter, manuelle Korrektur), (4) Nachweis im Demo/PoC. Diese Disziplin ist ein Kernbestandteil der strukturierte Softwareauswahl – sie verhindert, dass Integrationen erst nach dem Beschluss „auftauchen“.
Abschlussgedanke: Fassen Sie die Ergebnisse jeder Etappe knapp zusammen und halten Sie Annahmen explizit. So bleibt die strukturierte Softwareauswahl schlank, nachvollziehbar und beschlussfähig – statt zu einer weiteren Dokumentationsübung zu werden. Wenn Sie den Prozess konsequent leben, wird die strukturierte Softwareauswahl vom Buzzword zur Arbeitsweise, die Ihrem Team Zeit, Nerven und Budget spart.
Methodische Tiefe – wenig Werkzeuge, viel Wirkung
Nutzwertanalyse (NWA): Legen Sie 6–10 Kriterienbündel fest (z. B. Prozess-Fit, Integrations-Fit, Roadmap-Passung, Total Cost of Ownership, Referenzen, nicht-funktionale Eigenschaften), gewichten Sie diese und dokumentieren Sie je Kriterium eine knappe Begründung. Die Rechenlogik ist einfach: je Anbieter definieren Sie Teil-Scores pro Kriterium, multiplizieren mit dem Gewicht und summieren die Ergebnisse. Wichtig ist nicht die Mathematik, sondern der Audit-Trail: Begründungen, Quellen/Belege, Stand (Datum/Version).
Prozesssicht mit BPMN: Statt Features abzufragen („gibt es Retouren?“) wird der Prozess beschrieben: Actor, Trigger, Pre-Conditions, Steps, Events, Post-Conditions, KPIs. Demos liefern Nachweise entlang des Flows. Ein Beispiel aus dem Handel: „Retouren mit Seriennummer & Preisgutschrift“ (inkl. Gutschriftlogik, Bestand, Accounting-Auswirkung). Ergebnis: weniger Show, mehr belastbare Evidenz.
Qualitätsmodell ISO/IEC 25010: Denken Sie nicht-funktionale Anforderungen strukturiert: Zuverlässigkeit, Wartbarkeit, Portabilität, Benutzbarkeit. Verankern Sie 2–3 konkrete Nachweise pro Qualitätsaspekt in Demos/PoCs (z. B. „Wie dokumentieren wir Änderungen?“, „Wie schnell ist die Wiederherstellung typischer Fehlerzustände?“).
Event-basierte Integration: Definieren Sie je Fluss Goldene Quelle (System of Record), Event-Schema (mit Version), Ziel-Latenzen (p95/p99), Fehlerstrategien (Retry/Dead-Letter) sowie Idempotenz (Dedup nach Event-ID). Akzeptieren Sie in hochfrequenten Flüssen „at-least-once“ mit Deduplikation an der Senke; „exactly-once“ ist im Verbund selten realistisch. Diese Klarheit reduziert Integrationsrisiken erheblich.
Vorteile gegenüber klassischen Alternativen
- Gegenüber reiner Eigenrecherche: Statt Wochen an Links zu sichten, starten Sie in Minuten – mit einer neutralen, begründeten Basis.
- Gegenüber Review-Portalen: Sterne helfen beim Stimmungsbild, nicht bei Prozess- und Integrations-Fit. Strukturierte Auswahl liefert Use-Case-Nachweise statt Meinungen.
- Gegenüber Fragebogen-Tools: Kein Zeitverlust durch hunderte Pflichtfelder. Sie priorisieren echte Szenarien und leiten daraus fokussierte Demos ab.
Interne Links – wo Sie weiter vertiefen
- Find-Your-Software – Blog (übergreifende Perspektiven, Auswahlprinzipien, Praxis-Leitfäden)
- Find-Your-ERP – Blog/Insights (Auswahl, Demos, Trends)
- Find-Your-HR – Blog (HR-Use-Cases, Einführung, Vergleichsartikel)
Externe Orientierung (neutral, hilfreich, 3–5 Links)
- Nutzwertanalyse – strukturierte Bewertung mit Gewichtungen und Begründungen.
- ISO/IEC 25010 – Qualitätsmodell für Software-Produkte.
- BPMN 2.0.2 – Prozesse so modellieren, dass Demos sie belegen können.
- Event-Driven Architecture – warum Ereignisse, Latenzen und Fehlerpfade zählen.
Tabellen-Snippet 3: Phasenplan & Artefakte – minimal, aber wirksam
| Phase | Ziel | Pflicht-Artefakte | Exit-Kriterium |
|---|---|---|---|
| Pre-Matching | Neutrale Shortlist | Shortlist-Export, Annahmen-Notiz | 3–6 Kandidaten mit Begründung |
| Use-Cases & Demos | Nachweis realer Abläufe | Demo-Drehbuch, Nachweis-Protokoll | ≥ 85 % Nachweise erfüllt |
| Vergleich & Bewertung | Transparente Scores | Bewertungsjournal (Gewichte + Begründungen) | Gewichtete Empfehlung „unter Annahmen“ |
| Vorlage & Beschluss | Gremium entscheidet | One-Pager (Ziel, Varianten, Empfehlung, Risiken) | Beschluss oder Rückfragen-Liste |
Wie Sie heute starten – Schritt für Schritt
- Matching starten: Öffnen Sie Find-Your-Software und erzeugen Sie in wenigen Minuten eine neutrale, begründete Erst-Shortlist.
- Domäne wählen: Vertiefen Sie – je nach Fokus – über Find-Your-ERP, Find-Your-HR, Find-Your-ESG oder werfen Sie einen Blick in die CRM-Preview.
- Use-Cases fixieren: Beschreiben Sie 6–10 Szenarien mit Nachweispunkten (Steps, Daten, Ausnahmen, KPIs). Diese Liste wird zum Drehbuch für alle Demos.
- Bewertung strukturieren: Legen Sie Gewichtungen fest (Nutzwertanalyse), halten Sie je Kriterium eine Begründung fest und pflegen Sie das Bewertungsjournal.
- Integrationen & TCO sichern: Füllen Sie die Integrationsmatrix (Quelle/Ziel, Ereignisse, Latenz, Fehlerstrategie, Führungshoheit) und rechnen Sie drei TCO-Szenarien (Baseline/Rollout/Wachstum).
- Vorlage beschlussfähig machen: Verdichten Sie alles auf einen One-Pager – mit Empfehlung unter Annahmen und klaren nächsten Schritten.
FAQ zur strukturierten Softwareauswahl
Wie schnell komme ich zu einer ersten Shortlist?
In der Regel in wenigen Minuten. Ziel ist ein schneller, neutraler Einstieg – nicht das endgültige Urteil. Die Shortlist dient als Arbeitsgrundlage, die Sie gezielt verfeinern.
Ist das Ergebnis eine Black Box?
Nein. Die Empfehlungen sind begründet und dienen der Diskussion: Sie sehen, warum ein System vorgeschlagen wird, und können Szenarien/Annahmen anpassen.
Was passiert nach dem Pre-Matching?
Sie vertiefen im Team: Kandidaten vergleichen, Demos durchführen, Nachweise und Bewertungen dokumentieren, Integrationen und TCO prüfen – bis zur entscheidungsreifen Vorlage.
Gibt es spezialisierte Einstiege?
Ja. Für ERP, HR und ESG stehen dedizierte Portale bereit; für CRM existiert eine Beta-Vorschau. So kommen Sie schneller von „allgemein“ zu „domänenspezifisch“.
Fazit: Strukturierte Softwareauswahl heißt nicht „mehr Papier“, sondern mehr Klarheit: schnell starten, neutral bleiben, gezielt vertiefen, sauber entscheiden. Wenn Sie sofort loslegen möchten, testen Sie das Matching auf Find-Your-Software – und nutzen Sie anschließend die spezialisierten Einstiege zu ERP, HR, ESG sowie die CRM-Preview, um Ihre Entscheidung einfach und effizient bis zum Beschluss zu führen.